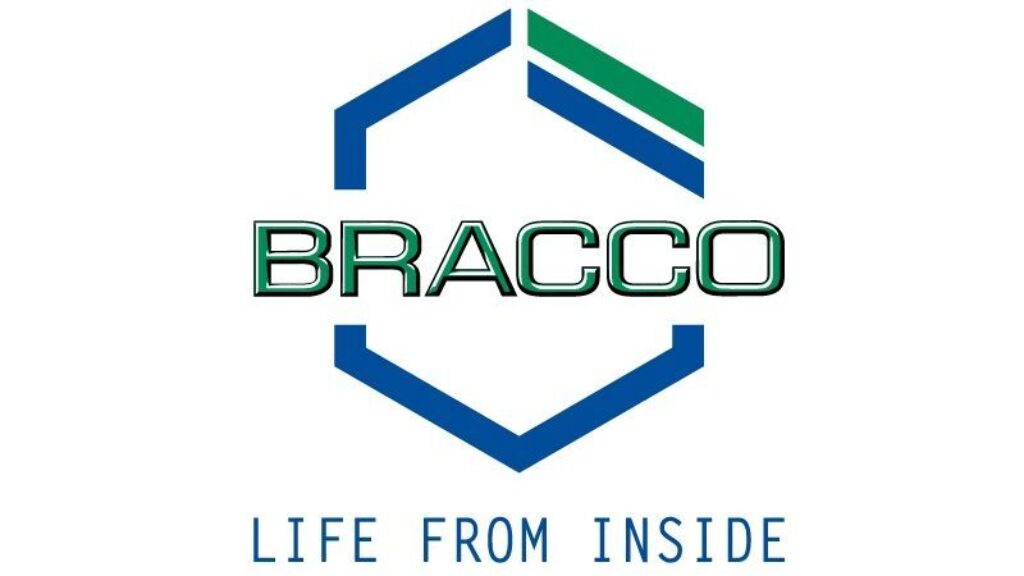Ob Fluch oder Segen – KI hält auch an Schulen und Universitäten Einzug
Monika Casiero
Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich rasant und findet in unterschiedlichen Lebensbereichen Anwendung. Im Bildungsbereich eröffnet KI zahlreiche Vorteile, bringt aber auch Herausforderungen mit sich – insbesondere im Bereich von Diplomarbeiten und Prüfungen. Die Texte, die von ChatGPT erstellt werden, lassen sich gar nicht so leicht von denen eines Menschen unterscheiden. Ein Freipass für Studierende, die ihre Arbeiten künftig ChatGPT & Co in Auftrag geben, oder eine sinnvolle Arbeitserleichterung? Ob positiv oder negativ – die Entwicklung im Bereich künstliche Intelligenz ist unausweichlich. Wir haben bei drei Bildungsanbietern (Lehrgang dipl. Radiologiefachpersonen HF/FH) nachgefragt, wie sie mit KI umgehen und ob sie diesbezüglich Richtlinien entwickelt haben.
Das Interview wurde mit Arletta Collé (Careum Bildungszentrum Zürich), Gisela Salm (Medi; Zentrum für medizinische Bildung, Bern) und Isabelle Gremion (Haute Ecole de Santé Vaud, HES-SO) schriftlich durchgeführt.
Gibt es rechtliche Vorgaben betreffend KI und Diplomarbeiten oder erhalten Studierende eine Information von euch Bildungsanbietern?
Careum, Arletta Collé:
Wir erarbeiten am Careum Bildungszentrum Zürich derzeit einen neuen Leitfaden zur Zitierweise (aktuelle APA-Zitierweise). Darin sollen auch Vorgaben zu KI/ChatGPT integriert werden. Die Studierenden werden bis dahin von den pädagogischen Mitarbeitenden über den korrekten Umgang sowie die Deklaration informiert.
Medi, Gisela Salm:
Unser Leitfaden am Medi Bern wurde bereits aktualisiert – inklusive Vorgaben zu KI und ChatGPT.
HES-SO, Isabelle Gremion:
Die gesetzlichen Bestimmungen sind die des Bundesgesetzes über das Urheberrecht, URG. Unsere Studierenden bestätigen zu Beginn ihrer Arbeit, dass sie für die Stellungnahmen und Schlussfolgerungen ihrer Arbeit allein verantwortlich sind, und bestätigen, dass sie ihre Arbeit eigenständig erstellt haben und keine anderen als die im Referenzverzeichnis genannten Quellen verwendet haben.
Darf jeder Schulanbieter und jede Universität seine eigenen Richtlinien zum Thema KI verfassen?
Careum, Arletta Collé und Medi, Gisela Salm:
Ja, uns ist keine übergeordnete Weisung, etwa durch den Kanton Zürich oder den Kanton Bern, bekannt.
HES-SO, Isabelle Gremion:
Jeder Bildungsanbieter und jede Hochschule kann ihre eigenen Richtlinien verfassen. Die kürzlich gegründete Task Force «KI Education» der HES-SO bietet Studierenden und Dozierenden Unterstützung in Form von Empfehlungen, Leitfäden und Merkblättern zu Kursen, Evaluationen und Forschung an.
Wie werden Diplomarbeiten auf Plagiate geprüft?
Careum, Arletta Collé:
Das Careum Bildungszentrum Zürich nutzt das Programm «Copy-stop». Das Programm wird seitens Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) des Kantons Zürich zur Verfügung gestellt und unterstützt Dozierende bei der Erkennung von Plagiaten. Sämtliche Arbeiten werden am Careum Zürich mit «Copy-stop» geprüft.
Medi, Gisela Salm:
Bei Verdacht auf Plagiate wird beispielsweise das Poster im 2. Ausbildungsjahr ebenfalls mittels eines Programms auf Plagiate hin geprüft. Der Vorteil ist, dass alle erfassten Arbeiten miteinander querverglichen werden. So sind schon Vollplagiate entdeckt worden.
HES-SO, Isabelle Gremion:
Die HES-SO stellt die Anti-Plagiatssoftware «Compilatio» sowie Dokumentationen und Tutorials zur Verfügung. Den Studierenden wird ein begrenzter Zugang zur Software (Compilatio) angeboten, der es ihnen ermöglicht, 40 Seiten pro Jahr zu analysieren, damit sie nicht wegen Copy-Paste und anderen Formen des Plagiats bestraft werden.
Und wie wird überprüft, ob eine Diplomarbeit mittels KI/ChatGPT erstellt wurde?
Careum, Arletta Collé:
Auch hier nutzen wir das Programm «Copy-stop» – durch den Quervergleich kann das Programm einen Hinweis geben. Doch wir verlassen uns nicht nur auf das Programm, denn nicht immer meldet es Auffälligkeiten. Wenn wir die Arbeit lesen und zum Beispiel unterschiedliche Schreibstile entdecken, fällt auf, dass KI oder ChatGPT im Einsatz waren. Spätestens an der mündlichen Prüfung (Fachgespräch) stellt sich heraus, ob die Studierenden die Diplomarbeit selbst verfasst haben oder nicht.
Medi, Gisela Salm:
Derzeit wenden wir keine spezifische Software an, welche von ChatGPT oder anderen KI-Tools geschriebene Texte erkennt. Anscheinend sind aber Universitäten daran, hier die Lücke zu schliessen.
HES-SO, Isabelle Gremion:
Wir verwenden derzeit keine Software, um zu überprüfen, ob eine Arbeit mithilfe von KI/ChatGPT verfasst wurde. Die Verwendung von KI/ChatGPT muss von den Studierenden als Quelle angegeben werden.
Ich habe eine Diplomarbeit geschrieben und möchte die Rechtschreibung und Grammatik meiner Diplomarbeit prüfen. Wäre das erlaubt oder ist es dann ein Plagiat?
Careum, Arletta Collé:
Im Careum müssen diese Textpassagen zurzeit in blauer Schrift hervorgehoben werden. Mit der Einführung des neuen Leitfadens zur Zitierweise kann es diesbezüglich zu Änderungen kommen.
Medi, Gisela Salm:
Sofern im Literaturverzeichnis angegeben wird, welche Software zur Anwendung gekommen ist, kann die Arbeit mit Tools geprüft werden. Generell gesagt ist sicher wichtig, dass die Richtlinien der jeweiligen Bildungsinstitute berücksichtigt werden. Die Eigenleistung der Studierenden muss zudem vorhanden und klar ersichtlich sein.
HES-SO, Isabelle Gremion:
Dies ist erlaubt. Die Nutzung von ChatGPT kann den Studierenden helfen, ihre Schreibfähigkeiten zu verbessern. Allerdings müssen die Student:innen über ihre Verantwortung bei der Verwendung generativer KI aufgeklärt werden. Die Aufklärungsarbeit sollte auch die Frage nach den inhärenten Verzerrungen der generativen KI beinhalten. Jede Produktion, die mithilfe einer generativen KI erzeugt wird, bleibt in der Verantwortung des Nutzers oder der Nutzerin, der oder die sowohl ihren Wahrheitsgehalt als auch ihre Übereinstimmung mit den Regeln der Ethik und des geistigen Eigentums überprüfen muss.
Welche rechtlichen Konsequenzen haben Studierende zu befürchten, wenn sie Diplomarbeiten mittels KI/ChatGPT schreiben?
Careum, Arletta Collé:
Bei uns verhält es sich ähnlich, allerdings werden die Arbeiten dann teilweise mit Korrekturen zurückgewiesen.
Medi, Gisela Salm:
Wenn belegt werden kann, dass die Arbeit Plagiate enthält, wird die Arbeit ohne Korrektur zurückgewiesen. Es wird als Plagiat ausgewiesen. Eine Wiederholung der Arbeit innerhalb von vier Wochen ist möglich.
HES-SO, Isabelle Gremion:
Die Studierenden werden mit der Nichtanerkennung ihrer Arbeit bestraft, wenn der Einsatz von KI/ChatGPT zeigt, dass ihre Arbeit nicht authentisch genug ist, gegen das Urheberrecht verstösst oder die Zitierregeln nicht beachtet wurden. Generative KIs gelten als Drittautoren und müssen zitiert werden, wenn sie verwendet wurden.
Möchtet ihr noch auf etwas hinweisen?
Careum, Arletta Collé und Medi, Gisela Salm
Die Rückmeldungen entsprechen dem heutigen Stand. Die Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz schreitet rasch voran. Dies erfordert, dass wir uns stetig mit den neusten Möglichkeiten auseinandersetzen und unsere Richtlinien laufend aktualisieren.
HES-SO, Isabelle Gremion:
Die an der HES-SO umgesetzten Projekte und Einrichtungen werden die Studierenden sowie die Dozierenden bei den im Zeitalter der generativen KI zu erwerbenden Kompetenzen unterstützen. Im Januar 2024 wurde mit der Umsetzung eines Aktionsplans begonnen, und die HES-SO wird regelmässig darüber berichten.
Einen interessanten Kommentar zum Thema «Das KI-Paradox in der Ausbildung» bietet Matthias Zehnder, Schweizer Journalist und Buchautor. Link
Kontakt
Monika Casiero
Radiologie Hirslanden Zürich
Leiterin MTR Nuklearmedizin
Witellikerstrasse 40
8032 Zürich
monika.casiero@hirslanden.ch
Interviewte Bildungsinstitutionen
Arletta Collé
Leiterin Bildungsgang HF medizinisch-technische Radiologie
Careum Bildungszentrum Zürich, arletta.colle@careum-bildungszentrum.ch
Gisela Salm
Leiterin Bildungsgang Medizinisch Technische Radiologie HF
Medi; Zentrum für medizinische Bildung, Bern, gisela.salm@medi.ch
Isabelle Gremion
Dozentin, Verantwortliche praktische Ausbildung
Haute Ecole de Santé Vaud, HES-SO, isabelle.gremion@hesav.ch
Weitere Fachartikel
27.05.2025
Virtopsy® – Postmortale Bildgebung in der modernen Rechtsmedizin
Virtopsy® – die virtuelle Autopsie – revolutioniert die rechtsmedizinische Diagnostik: Mit modernen Bildgebungsverfahren wie CT, MRT und MRS lässt sich der menschliche Körper nach dem Tod präzise untersuchen – ganz ohne Skalpell. Die Methode erlaubt nicht nur eine detaillierte Befunddokumentation, sondern eröffnet neue Perspektiven für die forensische Aufklärung.
15.04.2025
Fehlerhafte Anmeldungen in der Radiologie
In der Radiologie stellt das Problem fehlerhafter Anmeldungen durch interne und externe Zuweiser:innen eine zunehmende Herausforderung dar. Solche Anmeldungen führen zu einem erheblichen Mehraufwand für Radiologiefachpersonen und belasten den Arbeitsalltag. Die Ursachen sind vielfältig, und die daraus resultierenden Folgen betreffen nicht nur die Arbeitsprozesse des medizinischen Fachpersonals, sondern auch die Effizienz und Kosten im Gesundheitssystem.
25.03.2025
Radiologie und Patientenerfahrung: Was eine bislang einzigartige Umfrage in der Romandie offenbart
Die Zufriedenheit der Patient:innen stellt in der Röntgendiagnostik einen wesentlichen Aspekt dar. Eine Umfrage aus der Westschweiz zeigt, dass die Mehrheit der Patient:innen insgesamt zufrieden ist, wobei jedoch signifikante Unterschiede zwischen den verschiedenen Einrichtungen und Patientengruppen bestehen. Während menschliche Interaktionen und die Sauberkeit sehr geschätzt werden, gibt es noch Verbesserungspotenzial in Bezug auf Wartezeiten und den Komfort. Die Ergebnisse verdeutlichen, wie wichtig ein patientenzentrierter Ansatz ist, um eine positive Erfahrung in der Radiologie sicherzustellen.
17.03.2025
Planet Radiology: Nachhaltigkeit und Innovation im Fokus des ECR 2025
Der Europäische Radiologiekongress (ECR) 2025 stand unter dem Motto «Planet Radiology» und widmete sich den zentralen Herausforderungen der modernen Medizin: Nachhaltigkeit, globale Gesundheitsgerechtigkeit und wissenschaftlicher Fortschritt. Vom 26. Februar bis 2. März 2025 luden die Verantwortlichen der European Society of Radiology Radiologinnen und Radiologen, Radiologiefachpersonen, Industriepartner:innen und Expert:innen aus aller Welt nach Wien ein, um die Zukunft der Bildgebung zu gestalten.