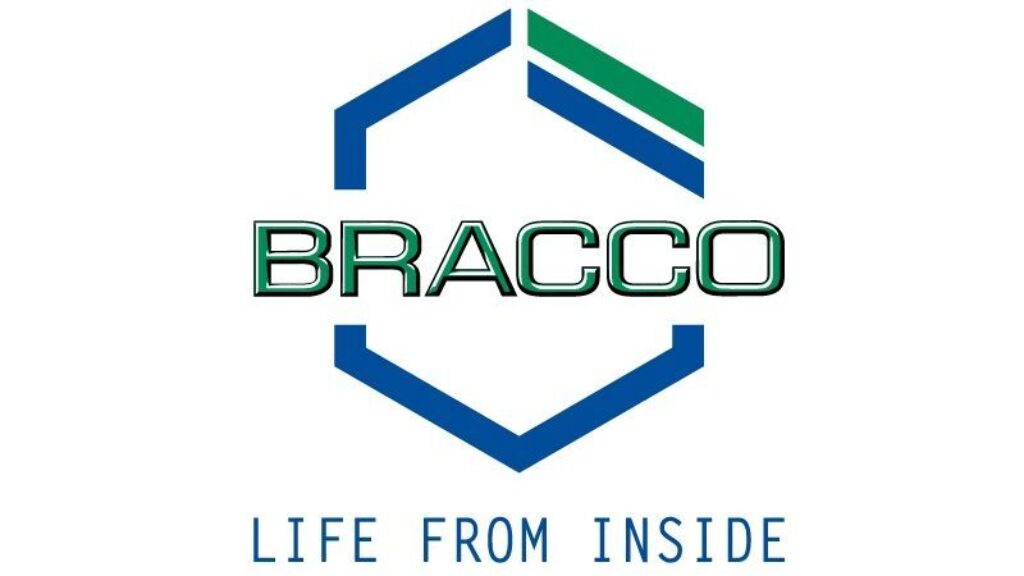SASRO-Kongress 2024: Vernetzung und neue Perspektiven in der Radio-Onkologie
Martina Bürgi
Vom 19. bis 21. September 2024wurde das alljährliche SASRO-Meeting abgehal-ten. Zum 28. SASRO-Kongress fanden sich ungefähr 500 Teilnehmendeauf demCAMPUS-Geländein Surseeein. Das Thema des diesjährigenKongresses lautete«Learning HealthSystems: collection ofevaluable data, datatransformation intoknowledge,feedback topatient value». VielespannendePräsentationenrund umdiesesThema sowie zu weiterenAspektenwurden gehalten.
Am ersten Tag der Konferenz gab es – ausser dem Treffen der leitenden Radiologiefachpersonen – noch keine Extra-Sessions für Radiologiefachpersonen. Nichtsdestotrotz gab es einige Talks, welche auch für unsere Berufsgruppe lohnenswert zum Zuhören waren. So stellte beispielsweise Lisa Milan vom EOC Spital Bellinzona die klinische Implementierung eines MR-Only-Workflows für die intrakranielle Radiotherapie-Behandlung vor. Vermutlich werden sich die «MR-Only-Workflows» künftig je länger, je mehr etablieren, zumindest in den grösseren Kliniken. Daher kann es hilfreich sein, von den Erfahrungen der Spitäler zu hören, welche bereits solche Arbeitsabläufe in den Alltag integriert haben, und davon zu profitieren. Am ersten Kongress-Abend fand schliesslich auch noch das traditionelle «Speakers Dinner» im Restaurant Baragge in Sursee statt. Alle Personen, die während des Kongresses eine Präsentation gehalten haben, wurden eingeladen und mit leckeren Hamburgern verwöhnt.Cyberangriffe auf Gesundheitseinrichtungen
Gut gestärkt ging es am Freitag weiter. An diesem Tag waren deutlich mehr Personen anwesend als noch am Vortag. Zu Beginn des Tages widmete sich eine Session dem Thema «Cyberattacks». Eindrücklich wurden Beispiele bereits stattgefundener Attacken auf Spitäler gezeigt: Nicht nur in weit entfernten Ländern (wie z. B. Kanada) gab es in der Vergangenheit bereits solche Angriffe, sondern auch in Europa (unter anderem in Spanien oder Irland). Die Folgen waren verheerend: So hatte man beispielsweise keinen Zugriff mehr auf die Krankenakten, die Bestrahlungsplanung sowie die Durchführung und Dokumentation der Bestrahlung waren nicht mehr möglich usw. Bis der Normalzustand wiederhergestellt werden konnte, dauerte es Tage bis sogar Monate! Umso wichtiger scheint es, dass wir uns die Empfehlungen und Vorschriften seitens IT-Abteilung zu Herzen nehmen und umsetzen, damit solche Vorfälle möglichst vermieden werden können.
Multikulturelle Teams – Vorteile und Herausforderungen
Um 11 Uhr startete die erste RTT-Session. Das Hauptthema «Bestrahlungsplanung» erfreute sich grosser Beliebtheit – der Seminarraum war so gut besucht, dass einige Personen sogar stehen mussten. Am Nachmittag ging es nach dem Mittags-Lunch mit spannenden Themen weiter. Die Thematik des multikulturellen Teams wurde gleich zweimal diskutiert. Es wurden sowohl die Vorteile als auch die Herausforderungen, wie beispielsweise Verständigungsprobleme – nicht nur auf der verbalen Ebene – aufgezeigt. Wichtig ist sicherlich, dass man sich diesen Herausforderungen bewusst ist und die Spitäler beziehungsweise Institute Unterstützung anbieten, falls es zu ernsthafteren Problemen kommt.
Nebst den vielen Präsentationen gab es auch immer wieder Gelegenheiten, sich die zahlreichen Poster anzuschauen oder sich mit anderen Personen (sei es aus der gleichen oder einer anderen Berufsgruppe, sei es mit einem bekannten oder neuen Gesicht) auszutauschen. Die Pausen, sowie der Social Event, welcher am Freitagabend auf dem Campus-Gelände stattfand, waren bestens geeignet fürs Networking. Immer wieder entstanden angeregte Diskussionen zu verschiedensten Themen. Auch der Stand der SVMTR wurde trotz des eher versteckten Standorts häufig besucht. Die «Röntgen-Socken» erfreuten sich einmal mehr grosser Beliebtheit. Übrigens: Die Socken können nun jederzeit unter folgendem Link bestellt werden: Link anwählen
Vergleichsstudie am USZ: Offene vs. geschlossene Masken
Am Samstag fanden am Vormittag die letzten RTT-Sessions statt. Obwohl das eine oder andere Gesicht doch noch etwas müde wirkte, war der Seminarraum erneut gut besucht. Es wurde unter anderem eine Studie vorgestellt, welche im Universitätsspital Zürich (USZ) durchgeführt worden ist. In der Studie wurden geschlossene Masken mit solchen verglichen, bei denen ein Teil des Gesichtes frei bleibt. Die Ziele der Studie waren, die Auswirkungen der Masken mit offenem Gesicht auf den Komfort und die Präferenz der Patientinnen und Patienten im Vergleich zu geschlossenen Masken zu untersuchen sowie zu ermitteln, wie gut die «open-face»-Masken immobilisieren. Betreffend auf das erste Ziel waren die Resultate eindeutig: Die zu behandelnden Personen verspürten mit den offenen Masken signifikant seltener Angst und Schmerzen. 27 der insgesamt 29 teilnehmenden Personen bevorzugten die offenen Masken. Bezüglich der Immobilisierungs-Genauigkeit wurde erläutert, dass bei den offenen Masken die interfraktionellen Schwankungen der Verschiebungen – mit Ausnahme der lateralen Verschiebung – zwar grösser waren im Vergleich zu den geschlossenen Masken. Bei den intrafraktionellen Schwankungen konnte aber kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Masken-Typen festgestellt werden. Trotz der positiven Ergebnisse ist im USZ nach wie vor die geschlossene Maske der Standard. Wer weiss, ob sich der andere Masken-Typ mit dem offenen Gesicht aber mithilfe weiterer Studien sowie im Laufe der Zeit aber doch vermehrt durchsetzen wird.
Kurz zusammengefasst lässt sich sagen, dass auch der diesjährige SASRO-Kongress ein Erfolg war und einmal mehr gezeigt hat, dass Radiotherapie so viel mehr ist als nur «Knöpfchen drücken»! 2025 wird der Kongress vom 11. bis 13. September in Davos stattfinden. Sind wir gespannt, welche aktuelle Themen und Weiterentwicklungen dann auf uns warten.
Weitere Fachartikel
27.05.2025
Virtopsy® – Postmortale Bildgebung in der modernen Rechtsmedizin
Virtopsy® – die virtuelle Autopsie – revolutioniert die rechtsmedizinische Diagnostik: Mit modernen Bildgebungsverfahren wie CT, MRT und MRS lässt sich der menschliche Körper nach dem Tod präzise untersuchen – ganz ohne Skalpell. Die Methode erlaubt nicht nur eine detaillierte Befunddokumentation, sondern eröffnet neue Perspektiven für die forensische Aufklärung.
15.04.2025
Fehlerhafte Anmeldungen in der Radiologie
In der Radiologie stellt das Problem fehlerhafter Anmeldungen durch interne und externe Zuweiser:innen eine zunehmende Herausforderung dar. Solche Anmeldungen führen zu einem erheblichen Mehraufwand für Radiologiefachpersonen und belasten den Arbeitsalltag. Die Ursachen sind vielfältig, und die daraus resultierenden Folgen betreffen nicht nur die Arbeitsprozesse des medizinischen Fachpersonals, sondern auch die Effizienz und Kosten im Gesundheitssystem.
25.03.2025
Radiologie und Patientenerfahrung: Was eine bislang einzigartige Umfrage in der Romandie offenbart
Die Zufriedenheit der Patient:innen stellt in der Röntgendiagnostik einen wesentlichen Aspekt dar. Eine Umfrage aus der Westschweiz zeigt, dass die Mehrheit der Patient:innen insgesamt zufrieden ist, wobei jedoch signifikante Unterschiede zwischen den verschiedenen Einrichtungen und Patientengruppen bestehen. Während menschliche Interaktionen und die Sauberkeit sehr geschätzt werden, gibt es noch Verbesserungspotenzial in Bezug auf Wartezeiten und den Komfort. Die Ergebnisse verdeutlichen, wie wichtig ein patientenzentrierter Ansatz ist, um eine positive Erfahrung in der Radiologie sicherzustellen.
17.03.2025
Planet Radiology: Nachhaltigkeit und Innovation im Fokus des ECR 2025
Der Europäische Radiologiekongress (ECR) 2025 stand unter dem Motto «Planet Radiology» und widmete sich den zentralen Herausforderungen der modernen Medizin: Nachhaltigkeit, globale Gesundheitsgerechtigkeit und wissenschaftlicher Fortschritt. Vom 26. Februar bis 2. März 2025 luden die Verantwortlichen der European Society of Radiology Radiologinnen und Radiologen, Radiologiefachpersonen, Industriepartner:innen und Expert:innen aus aller Welt nach Wien ein, um die Zukunft der Bildgebung zu gestalten.