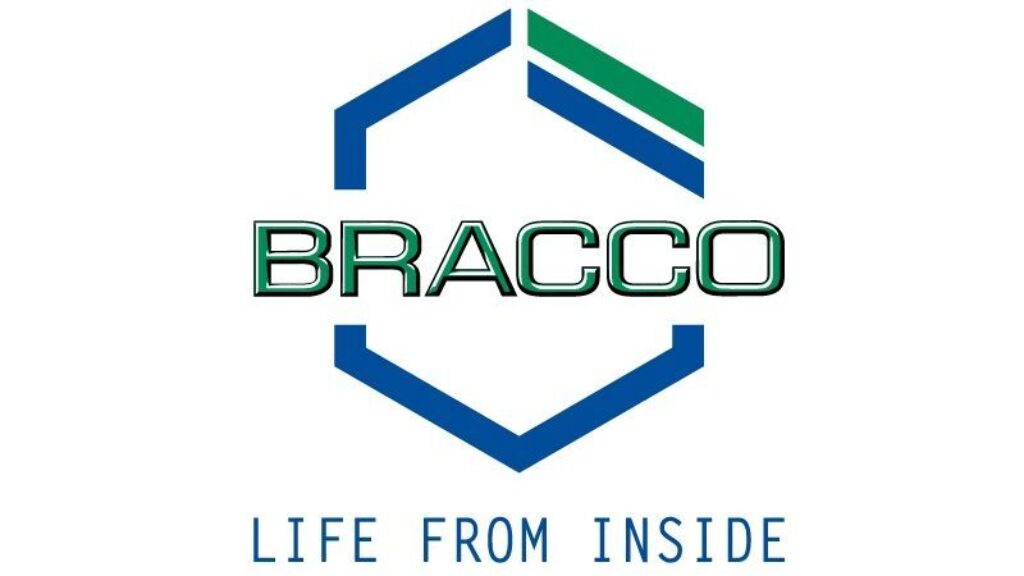Weitere Fachartikel
27.05.2025
Virtopsy® – Postmortale Bildgebung in der modernen Rechtsmedizin
Virtopsy® – die virtuelle Autopsie – revolutioniert die rechtsmedizinische Diagnostik: Mit modernen Bildgebungsverfahren wie CT, MRT und MRS lässt sich der menschliche Körper nach dem Tod präzise untersuchen – ganz ohne Skalpell. Die Methode erlaubt nicht nur eine detaillierte Befunddokumentation, sondern eröffnet neue Perspektiven für die forensische Aufklärung.
15.04.2025
Fehlerhafte Anmeldungen in der Radiologie
In der Radiologie stellt das Problem fehlerhafter Anmeldungen durch interne und externe Zuweiser:innen eine zunehmende Herausforderung dar. Solche Anmeldungen führen zu einem erheblichen Mehraufwand für Radiologiefachpersonen und belasten den Arbeitsalltag. Die Ursachen sind vielfältig, und die daraus resultierenden Folgen betreffen nicht nur die Arbeitsprozesse des medizinischen Fachpersonals, sondern auch die Effizienz und Kosten im Gesundheitssystem.
25.03.2025
Radiologie und Patientenerfahrung: Was eine bislang einzigartige Umfrage in der Romandie offenbart
Die Zufriedenheit der Patient:innen stellt in der Röntgendiagnostik einen wesentlichen Aspekt dar. Eine Umfrage aus der Westschweiz zeigt, dass die Mehrheit der Patient:innen insgesamt zufrieden ist, wobei jedoch signifikante Unterschiede zwischen den verschiedenen Einrichtungen und Patientengruppen bestehen. Während menschliche Interaktionen und die Sauberkeit sehr geschätzt werden, gibt es noch Verbesserungspotenzial in Bezug auf Wartezeiten und den Komfort. Die Ergebnisse verdeutlichen, wie wichtig ein patientenzentrierter Ansatz ist, um eine positive Erfahrung in der Radiologie sicherzustellen.
17.03.2025
Planet Radiology: Nachhaltigkeit und Innovation im Fokus des ECR 2025
Der Europäische Radiologiekongress (ECR) 2025 stand unter dem Motto «Planet Radiology» und widmete sich den zentralen Herausforderungen der modernen Medizin: Nachhaltigkeit, globale Gesundheitsgerechtigkeit und wissenschaftlicher Fortschritt. Vom 26. Februar bis 2. März 2025 luden die Verantwortlichen der European Society of Radiology Radiologinnen und Radiologen, Radiologiefachpersonen, Industriepartner:innen und Expert:innen aus aller Welt nach Wien ein, um die Zukunft der Bildgebung zu gestalten.